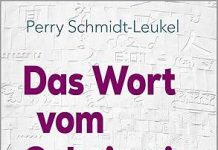In eine Kultur hineingeboren zu werden, ist wie ein Hemd mit dem ersten Atemzug anzuziehen – du kennst den Schneider nicht, hinterfragst den Stoff nicht. Was dir gegeben ist, nimmst du als selbstverständlich hin. Das gibt ein Gefühl von Sicherheit und Aufgehobensein, behindert aber die bewusste Wahrnehmung der eigenen Kultur als eine unter vielen. Genau in dieser Hinsicht setzt das Gastsein in einer anderen Kultur einen Lernprozess in Gang. Gast zu sein bedeutet: beobachten, Fremde erstmal wahrnehmen und gelten lassen. Es heißt, nicht zu urteilen, sondern zu verstehen.
Viele türkischstämmige Jugendliche in Deutschland haben zu wenig gelernt, die deutsche Gesellschaft aufmerksam zu beobachten – unter anderem weil sie sich nicht zugehörig fühlen. Am Tag nach dem Deutschland-Portugal-Spiel sprach ich mit Schülerinnen und Schülern einer fünften Klasse über Fußball. Als ich sagte, dass ich auch das Spiel angeschaut habe, fragte mich eine muslimische Schülerin: „Wem haben Sie die Daumen gedrückt?“ – „Natürlich Deutschland!“, antwortete ich. Daraufhin sagte sie in einem erstaunten Ton: ‚Deutschland?‘ Darin kam ein Befremden zum Ausdruck, das mich sehr verwunderte.
Die Finnland-Erfahrung der Austausch-Schülerin Melis ist gerade deshalb besonders. In einer kalten Region begab sie sich auf eine warme innere Reise. In der Stille der anderen hörte sie ihren eigenen Lärm. In der Bibliothek sah sie, wie jeder individuell arbeitet – und lernte dadurch den Wert des gemeinsamen Lernens an der eigenen Schule neu zu schätzen. Eines Abends aß sie bei einem finnischen Freund zu Abend und stellte fest, dass niemand vor dem Essen betet. Weder Mangel noch Überlegenheit – nur ein Unterschied. Und Unterschiedlichkeit macht den Menschen nicht kleiner, sondern größer. Auf der Rückreise murmelte sie: „Ich bin vielleicht keine Finnin geworden, aber wohl mehr Melis.“
Einheimisch zu sein heißt Wurzeln zu schlagen – in Sprache, Kultur, Geschichte und Werten. Doch das Ziel ist nicht nur Wurzeln zu schlagen, sondern auch in den Himmel zu wachsen. Sonst bleibt das Denken in einem Blumentopf und wächst nur so weit wie dieser reicht. Um Denken in einen Wald zu verwandeln, muss man andere Arten entdecken, andere Schönheiten wahrnehmen – und dort Gast sein. Wer nur die Topfpflanze bewundert, verpasst die Vielfalt des Waldes.
Was lässt sich denn durch interkulturelles Gastsein gewinnen?
Empathie
Ein Gast spielt nicht den Gastgeber. Er hört zu, will verstehen. Das ist ein Schritt, den egozentrisches Denken selten schafft. Mehmet zum Beispiel, der einige Monate freiwillig in Tibet gearbeitet hatte, sagte später: „Die Menschen dort erlebten Zeit ganz anders. Für uns waren sie langsam. Aber in ihrer Langsamkeit habe ich Raum für mich selbst gefunden.“ Das ist nicht nur kulturelle Beobachtung – darin zeigt sich ein Lernprozess. Empathie führt auch zu innerer Reife.
Ein bewussterer Umgang mit der eigenen Kultur
Sich selbst erkennt man oft besser im Spiegel des Anderen – wie wenn in einem dunklen Raum plötzlich das Licht angeht. Der berühmte Soziologe Ibn Khaldun bezeichnet den Wandel durch die Begegnung verschiedener Kulturen als ʿUmrān‘ – als eine Form gesellschaftlicher und kultureller Weiterentwicklung. Oft entsteht dabei eine neue Synthese.
Alev nahm zeitweise am Unterricht in einer protestantischen Schule teil, besuchte Weihnachtsgottesdienste, beobachtete religiöse Praktiken – und schrieb später in ihr Tagebuch: „Ich habe den Ramadan noch nie aus dieser Perspektive gesehen. Jetzt erkenne ich ihn nicht nur als religiöses Ritual, sondern auch als soziale Verbindung.“
Festgefahrene Vorstellungen werden erschüttert
Ein anderer kultureller Kontext kann vermeintlich „richtige“ Überzeugungen in Frage stellen. Zeynep etwa, die im Iran das Kopftuchgebot kritisiert, wurde in Paris wegen ihres Kopftuchs beschimpft – und fragte sich: „Wer definiert eigentlich Freiheit?“ Diese Frage wirkt in zwei Richtungen – nach innen und außen. Das ist der Kern vielschichtigen Denkens.
Erweiterung ästhetischer Wahrnehmung
Kulturelle Begegnung geschieht nicht nur über Ideen, sondern auch über Sinne. Emir, ein junger Musiker, beschreibt die Klänge einer Bambusflöte im Shinto-Tempel so: „Ich habe mich in diesen Tönen verloren – und meine eigene Melodie wiedergefunden.“ Auch ästhetische Erfahrungen formen Identität.
Ein Leben in Frieden mit Verschiedenheit
Vielleicht ist das der größte Gewinn. Ein Gast versucht nicht, den Gastgeber zu ändern. Er beobachtet, bemüht sich um Verständnis. Er muss nicht zustimmen, aber er lernt nicht zu verurteilen. Das ist der erste Schritt zu einem pluralistischen Denken.
Albert Einstein, aus jüdischer Familie, besuchte in seiner Jugend eine katholische Schule. Für seine kritischen Fragen im Religionsunterricht wurde er zwar nicht offiziell ausgeschlossen, aber häufig ausgegrenzt. Später sagte er: „Ich habe in allen Religionen das Menschliche gesucht. Nicht Gott hat mich interessiert, sondern der Mensch.“ Seine Universalität rührte offenbar daher, dass er sich nicht auf eine einzige Kultur beschränkte.
Wer ein Zuhause gründet, kennt das Leben; wer durch fremde Türen geht, wird weise und reif.